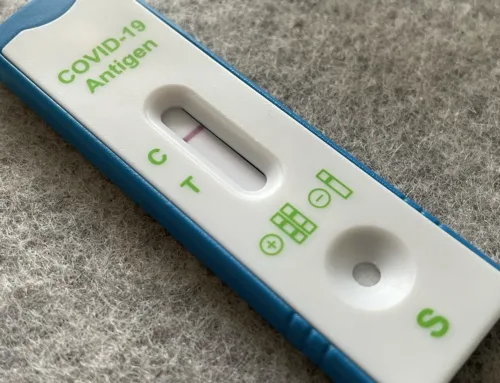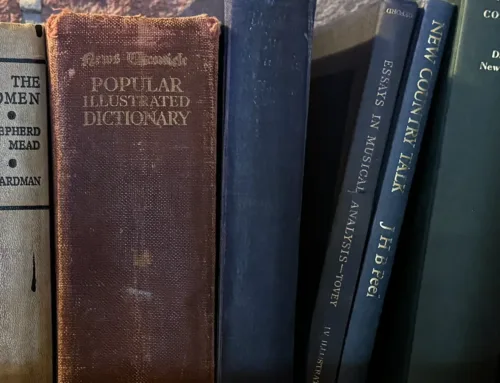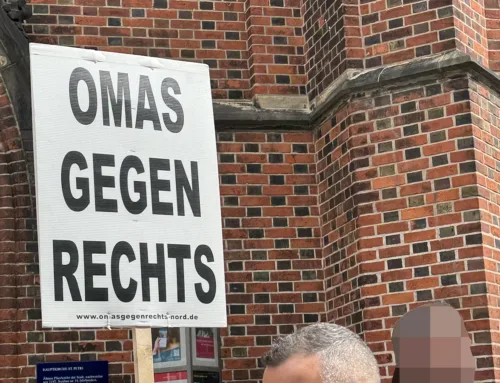In den 1980er Jahren, lange vor Google und Co., waren Eltern bei vielen Fragen und Alltagsproblemen auf sich gestellt. Dazu zählte auch die folgenreiche Entscheidung, auf welche Schule man die eigenen Kinder schickt. Mein Vater war ein Künstler und Freigeist, weshalb er es in seiner Kindheit nicht einfach hatte. Daher wünschte er sich für seine Kinder eine Schule, die Freiräume bietet und Kreativität fördert. Am Ende meldeten meine Eltern uns an der örtlichen Waldorfschule an. Für mich wurden es die schlimmsten 13 Jahre meines Lebens.
Der erste Schultag begann damals mit einem festen Ablauf: Die Eltern (die Zeit hatten) und die neuen Erstklässler*innen versammelten sich im Festsaal der Schule. Nach einer Feier, an die ich mich nicht mehr erinnere, wurden die Kinder von den Eltern getrennt und in den Klassenraum geschickt. Als ich in die Klasse kam, wurde ich mit dem einzigen anderen „Ausländer“ (aus Sicht des Lehrers; er war kein Ausländer, sondern einfach nur nicht weiß) an einen Tisch gesetzt. Es waren Zweiertische, muss man dazu vielleicht sagen. Damit war jedenfalls meine Rolle in der Klasse geklärt, ebenso wie die meines Banknachbarn Albert. Wir waren die Ausländer, die einzigen Nicht-Weißen des Jahrgangs. Meine Schulzeit startete direkt mit Ausgrenzung.
Das Problem an der Waldorfschule: Die Klassen bleiben von der ersten bis zur letzten Stufe zusammen. Wer in der ersten Klasse in einer Schublade landet, bleibt dreizehn Jahre dort. Ich war also dreizehn Jahre lang der Ausländer, der Chinese, die „Peking-Ente“ (der Typ, der das gesagt hat, ist mit etwa 20 an Leukämie gestorben). Da es fast nur Weiße auf der Schule gab, hatte ich keine Verbündeten. Lehrer, Schüler*innen, Eltern, sie alle ließen dreizehn Jahre lang ihren Rassismus an mir aus. Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, aber es würde eh niemand lesen. Es hat damals niemanden interessiert, und es würde auch heute niemanden interessieren.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Die meisten Täter*innen von damals würden heute leugnen, Rassist*innen zu sein. Kaum ein Schultag ist vergangen, ohne dass ich beleidigt, diskriminiert oder bedroht wurde. Lehrkräfte haben meine Meldungen abgetan, verharmlost oder geleugnet. Der Mitschüler Maik B. sagte einmal zu mir: „Ich finde es gut, was mit Hiroshima passiert ist.“ Ich habe gehört, dass er bei der Polizei gelandet ist. Wie passend. Wieso hat niemand zu mir gehalten? Ich hatte keine Freunde. Zumindest keine echten. Heute weiß ich das. Damals dachte ich, es wäre völlig normal, völlig allein zu sein.
Übergriffe von Lehrkräften gegenüber Schüler*innen gab es reihenweise an unserer Schule. Der Gartenbaulehrer H. hat einem Mitschüler während des Unterrichts ins Gesicht geschlagen, weil er ihm „zu laut“ war. Die Englischlehrerin A. hat demselben Schüler ebenfalls während des Unterrichts eine Backpfeife gegeben. Der Sportlehrer G. hat mich mal gepackt und kräftig geschüttelt, weil ich im Sportunterricht mal mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden war (ich habe sowas gerufen wie „der Ball war aus!“). Verstörend einfach. Meine Eltern haben das immerhin der Schulleitung gemeldet und es gab eine Konferenz, G. wurde aber nicht sanktioniert. Derselbe Typ hat Mädchen bei jeder Gelegenheit angefasst und ohne Grund ständig deren Umkleidekabine betreten, wie ich später von einer ehemaligen Mitschülerin erfahren habe.
Die unendliche Traurigkeit des Seins
Ich war schon als Kind besonders nachdenklich und sensibel. Für den ständigen Kampf war ich nicht gemacht. Als ich vor einigen Jahren – einige Stunden, bevor mein Vater gestorben ist – in der ehemaligen elterlichen Wohnung meine alten Sachen ausgemistet habe, ist mir ein Foto in die Hände gefallen. Es zeigt mich auf einem Rastplatz. Das Bild ist während eines Zwischenstopps auf der Rückfahrt von einer Klassenfahrt 1996 entstanden. Ich sehe in meinem Blick die unendliche Traurigkeit, die mich seit meiner Kindheit durchs Leben begleitet.
Seit meiner Kindheit werde ich immer wieder gefragt, wieso ich so traurig gucke. Lange Zeit dachte ich, das sei normal. Heute weiß ich, dass beides stimmt. Dass mich meine Schulzeit krank gemacht hat und dass es keine Heilung gibt. Und dass ich wieder und wieder zu hören bekommen werde, andere Menschen seien im Gegensatz zu mir „richtig krank“. Ob die Schule heute die Schüler*innen besser schützt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass unliebsame Google-Bewertungen gesperrt werden.